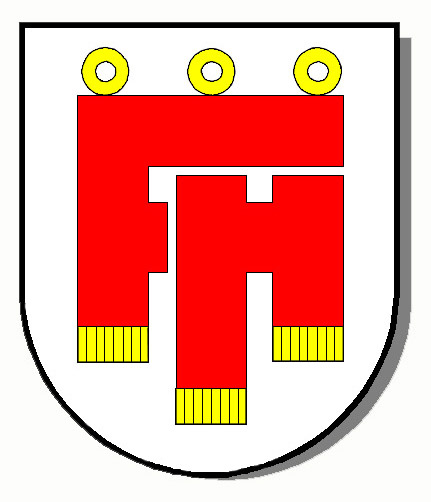Carl Gührer (*1872 in Tettnang, †1953 in...

Adolf Aich
Adolf Aich
(*1824 in Rottenburg, † 1909 in Untermarchtal)
Priester und Gründer der Stiftung Liebenau
Am 25. September 1824 wurde der Lehrerssohn Adolf Aich in Rottenburg/Neckar geboren. Nach dem Studium in Tübingen und Rottweil und der Priesterweihe 1851 war er Vikar in Leutkirch und Aichstetten. Danach folgte ein fünfjähriger Aufenthalt in der Schweiz, wo er unter anderem drei Jahre ein Lehramt in Rorschach innehatte.
Als durch den Tod des Pfarrers Michael Ritter von Jung die Kaplaneistelle St. Johann in Tettnang frei wurde, bewarb sich Aich erfolgreich und trat am 21. März 1859 die neue Stelle an. Neben der Seelsorge ergriff er die Initiative zur Restaurierung der verwahrlosten St. Johann-Kapelle, ein Aufwand, der über 2000 Gulden betragen sollte. Den Betrag brachte Aich auf Bettelfahrten in Süddeutschland und der Schweiz zusammen. Die Sanierung war 1865 abgeschlossen.
Schon in seiner Examensarbeit kam Aichs soziale Einstellung gegenüber Kranken und Pflegebedürftigen zum Ausdruck: „Im ganzen gesellschaftlichen Leben gibt es kaum einen edleren Dienst als den an den Kranken.“ Mit der Kaplaneistelle von St. Johann war eine Pflegestation mit seinerzeit 15 bis 18 Insassen verbunden. Ihnen und den Armen der Stadt Tettnang galt sein fürsorgliches Interesse. Seine Vorstellungen, ein gemeinsames Asyl für die Hilfebedürftigen der Armenhäuser und damit ein Krankenhaus für chronisch Leidende zu erstellen, nahmen konkrete Formen an. Informations- und Bettelreisen brachten weitere Erkenntnisse und finanzielle Unterstützung.
1866 gründete Aich mit zwölf Männern aus der Pfarrei Tettnang den St.-Johann-Verein mit dem Ziel, eine Pflegeanstalt für Unheilbare ins Leben zu rufen. In einem kleinen Haus in der heutigen Wilhelmstraße nahm die Anstalt im September 1866 ihre Pflegearbeit auf.
Nach diesem ersten Schritt arbeitete Aich an Plänen für eine größere “Sct. Gallus-Anstalt”. Vier Gründe führten zum Stopp des Vorhabens: Ablehnung der Anstalt durch einflussreiche Tettnanger Bürger, die hohen Kosten für einen Neubau, die Dringlichkeit einer baldigen Anstaltseröffnung und eine fehlende Wasserversorgung. Für 17.500 Gulden wurde stattdessen mit dem Schlösschen Liebenau im Juni 1870 das Kerngebäude der neuen Anstalt erworben und am 15. Oktober eröffnet. 1874 erreichte er, dass die Anstalt als juristische Person bürgerlichen Rechts anerkannt wurde. Auf eigenen Wunsch wandte er sich im gleichen Jahr wieder hauptamtlich der seelsorgerischen Tätigkeit zu: Er erhielt eine Pfarrstelle in Wilhelmskirch (Gemeinde Horgenzell), wo er bis zu seiner Pensionierung 1904 wirkte. Danach zog er nach Untermarchtal, wo er am 10. Juli 1909 starb und auch begraben ist.
Bis zu seinem Tode blieb Adolf Aich der Anstalt Liebenau als Verwaltungsrat, Ratgeber und Förderer eng verbunden. In Aichs Todesjahr war die Aufnahmekapazität auf 500 Insassen angestiegen.
Adolf Aich
Priester und Gründer der Stiftung Liebenau
Carl Gührer
Adolf Aich
Adolf Aich (*1824 in Rottenburg, † 1909 in...